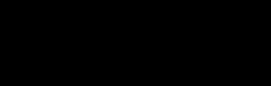Aus einem anderen LandDDR-Alltagsgegenstände und ihre ganz persönliche Geschichte
An welchen Gegenständen aus ihrer Vergangenheit hängen ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger besonders? Was nutzen sie weiterhin in ihrem Alltag? Was halten sie in Ehren? Und welche Erinnerung verbindet sich mit diesen Objekten? Wer diese Frage stellt, bekommt so manche interessante Geschichte zu hören: Mit kleinen Dingen wie einem Küchenquirl oder so großen wie einer Schrankwand verknüpfen sich Erinnerungen an ein verschwundenes Land, Erinnerungen an seine Schattenseiten, seine Glücksmomente und in erster Linie an seinen ganz normalen Alltag.
---------------------------------------------------
Dieses Projekt wurde in seinen Anfängen durch ein NEUSTART KULTUR-Stipendium gefördert
Ute und Manfred Mehner"Dr. Oetker kommt uns nicht ins Haus"
„Mit solchen Quirls bin ich aufgewachsen“, sagt die 67-Jährige. Das Utensil gab in es der DDR in drei Größen. Einer aus ihrer Sammlung ging kaputt. Seitdem sucht sie nach Ersatz. Doch ein ähnliches Küchenwerkzeug wird in der Bundesrepublik scheinbar nicht produziert. „So einen Quirl habe ich nie wieder gefunden,“ sagt sie. Was ist so besonders daran? „Mit ihm wird der Pudding cremiger.“ Und ihn zu benutzen sei einfach auch eine Gewohnheit. Man hängt eben an Dingen, die ein Leben lang zuverlässig zu Diensten waren.
Ihr Mann Manfred trinkt wiederum gerne sein Bier aus dem unzerbrechlichen Glas mit dem prägnanten Kopf von Karl Marx. Es stammt aus seiner Zeit in Chemnitz, das von 1953 bis 1990 Karl-Marx-Stadt hieß. Dort war er bis 1982 im Aufbaustab für das gigantische Heizkraftwerk Nord tätig. Es waren gute Jahre für ihn.
Manfred Mehner hat "Staat und Recht" studiert und war bereit, beim Aufbau seines Landes anzupacken. 1983 heirateten die beiden und er zog zu seiner Frau nach Berlin, wo er mit seiner Brigade neue Wohnviertel plante und baute. Wenige Jahre nach der Wende ging er in Frührente. Ute Mehner wurde in Potsdam zur Lehrerin ausgebildet. Mit 24 Jahren verlor sie ihr Gehör. Danach konnte sie nicht mehr unterrichten. Cochlea-Implantate sorgen heute dafür, dass man ihre Beeinträchtigung kaum wahrnimmt. Ein ähnliches Vorläufermodell bekam sie damals noch zu DDR-Zeiten als eine der ersten in der Ost-Berliner Charité eingesetzt. Auch medizinisch, so das Ehepaar, habe die DDR durchaus mit dem Westen mithalten können.
Quirl und Glas, das spürt man im Gespräch an ihrem gastlich gedeckten Couchtisch, tragen Geschichten und Erinnerungen an ihr Leben in der DDR, an das beide gerne zurückdenken. Es ging ihnen gut, sie waren überzeugte Staatsbürger und fremdeln noch immer mit so manchen vermeintlichen Vorzügen und Errungenschaften, die ihnen der Mauerfall bescherte. Vieles wurde bewusst schlecht geredet und hatte im Westen keine Chance, sagt Manfred Mehner.
Noch heute, 33 Jahre nach dem Mauerfall, achten sie beim Einkauf von Lebensmitteln auf deren vermeintliche Ost-Herkunft, orientieren sich an Marken, denen sie jahrzehntelang in der DDR vertrauten. Die Graupen schmeckten damals anders, sagt Manfred Mehner und meint: die Qualität der damaligen Produkte war einfach besser. „Dr. Oetker kommt uns nicht in Haus“, sagt er mit Überzeugung.
Doch mit der Wiedervereinigung verschwanden immer mehr der ihnen vertrauten Produkte aus den Regalen der Supermärkte. „Wir sind gelaufen und gelaufen, um bestimmte Dinge zu finden“, erinnert sich Ute Mehner. Was sie stattdessen fanden, schmeckte ihnen einfach nicht so gut wie das Original. Selbst die Zündhölzer waren anders und knickten beim Anzünden immer ab. „Streichbeene“ nennen die beiden sie und klären auf, dass man an solchen Begriffen nach wie vor den Ost- vom Westdeutschen unterscheiden könne.
Sie vermissen vieles – doch sie haben sich arrangiert und genießen ihr Leben in einer großzügigen Genossenschaftswohnung in einem mehrstöckigen Gebäude in Berlin-Mitte. Alle Bücher und 90 Prozent der Schallplatten in ihrer Schrankwand stammen aus DDR-Zeiten, sagt Manfred Mehner. Das Paar wohnt nur einen Steinwurf von dort, wo einst die Mauer die Stadt zerschnitt. Kreuzberg auf der anderen Seite, Westberlin, das ist für sie nach wie vor nicht ihre Welt. „Ost oder West, das spielt in unserer Generation schon noch eine Rolle“, sagt er. Es macht sie wütend, wenn andere in ihrer Generation abfällig über ihre ehemalige Heimat sprechen. Auf die lassen sie nach wie vor nichts kommen. „Was ich heute bin, habe ich der DDR zu verdanken“, sagt Manfred Mehner.
Beate und Armin StübeDer Glücksfall von der Leipziger Messe
Wie so viele im Kiez zogen sie quasi illegal ein – weil die Wohnung freistand und es einfach niemanden kümmerte. Es gab kein Schloss, erinnert sich Beate lachend. Wenn sie gingen, zogen sie die Klinke ab und versteckten sie. Die etwas seltsame Nachbarin, die ohnehin den ganzen Tag im Fenster lag, hielt die Tür im Auge. Viel zu holen gab es damals bei ihnen eh nicht.
Als Beate 1972 schwanger wurde, trugen sie ihre wenigen Sachen über Nacht im Schutz der Dunkelheit über den Innenhof in einen Seitenflügel. Dort wurde die bessere 2-Raum-Wohnung eines Nachbarn frei, der sich in den Westen abgesetzt hatte. „Man hat uns eine Plattenbauwohnung angeboten“, erinnert sich Armin, heute 74 Jahre alt. „Aber die haben wir dankend abgelehnt.“ Sie wollten unter den Künstler*innen und Lebenskünstler*innen im Prenzlauer Berg bleiben. Beate studierte damals Filmschnitt an der Filmhochschule Babelsberg, Armin Kunstwissenschaft an der Humboldt Uni Berlin und später Grafik an der Kunstschule Berlin Weißensee.
Heute, über 50 Jahre später, ist das Haus perfekt saniert, sie leben im Vorderhaus in einer schönen Vier-Zimmer-Wohnung und hängen sehr an „ihrem“ Haus, das damals ein ganz anderes war.
Nur ein einziges Möbelstück aus DDR-Zeiten steht noch im Wohnzimmer der schönen Altbauwohnung: Eine Hellerau-Schrankwand, die fast die gesamte linke Wand bedeckt. Sie hat als Möbelklassiker die Jahrzehnte überdauert: als Ort für ihre Bücher und Platten, nicht als Erinnerung an vergangene Zeiten, darauf legen beide Wert. „Sie ist zeitlos schön und bietet viel Stauraum“, sagt Beate. „Sie ist zweckmäßig, weil viele Bücher reinpassen“, ergänzt Armin. Mit der DDR verbinden die beiden höchstens die Geschichte, wie sie das gute Stück ergatterten:
Schmunzelnd erinnert sich Armin, ein grandioser Erzähler, wie er 1980 die Schrankwand im Möbelhaus am Alexanderplatz entdeckte. Ihr Sohn war damals acht Jahre alt. Die Familie hatte sich bis dahin kreativ eingerichtet – nie mit normierten DDR-Möbeln für die Plattenbau-Wohnung. Stattdessen nahmen sie mit, was die Laubenpieper in der nahen Kleingartenanlage auf die Straße stellten. Doch dann sollten ein paar Teppiche her. Im besagten Möbelhaus gab es nach der Leipziger Möbelmesse regelmäßig Rückläufer an Waren. Armin: „Also fuhr man da hin, um mal zu schauen.“
Der Laden öffnete um 10 Uhr und alle stürmten rein. Die Teppiche waren unerschwinglich. Doch dann stand im ersten Stock die Hellerau-Schrankwand und war gleich zu haben. Ein Designerstück in der Mangelwirtschaft – das war ein echter Glückstreffer. Sie entsprach einfach nicht dem gängigen Geschmack. „Schwarz will ja niemand“, ließ ihn die Verkäuferin wissen. Er wollte: Also reservierte Armin die Schrankwand, holte Geld ab und schwänzte seine Veranstaltung an der Humboldt-Uni. Nachbarn halfen, das schwere Möbelstück zu transportierten. Abends gab es dafür Bier und Würstchen.
Die beiden lachen viel, wenn sie sich an die ersten Jahre in der Straße erinnern, wie sie Kinder-Feste ausrichteten, gemeinsam mit Gleichgesinnten die Lücken im System und die Freiräume nutzten. Sie sind weder sentimental noch verärgert, wenn sie auf ihre Jahre in der DDR zurückblicken. Sie leben in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Sie schätzen das Schöne.
Das spiegelt auch ihre Wohnung. In ihr mischen sich Bauhaus-Stühle mit einer gebraucht erstandenen italienischen Design-Lampe, ergänzt durch ein modernes Sofa und jede Menge Kunst an den Wänden.
Die Hellerau-Schrankwand ist mit ihren vielen Büchern, Platten und der kleinen Bar noch heute das Ankerstück im Wohnzimmer, umgeben von Bildern. Denn: „Was vom Leben übrig bleibt, sind Bilder und Geschichten“, zitiert Armin den Berliner Maler Max Liebermann. Und schöne Möbel – egal aus welchem System sie stammen.
Dr. Axel DrieschnerWiderstand in Lederhosen
Axel Drieschner ist seit 2016 Kurator und Ausstellungsleiter des Museums, das zuvor nüchterner„Dokumentationszentrum für DDR-Alltagskultur“ hieß. Die hier ausgestellten Objekte stammen von ehemaligen DDR-Bürger*innen, die einem Aufruf folgten. Sie brachten Dinge, die für sie einen persönlichen Wert besaßen, Gegenstände, die nach der Wiedervereinigung vor dem Entsorgen und Vergessen gerettet werden sollten: Unter ihnen Fotoalben, Abzeichen, Radios, Geschirr, Kleidung, Platten, Spielwaren, Waschmaschine und Kühlschränke. "Wir haben alles - von der Stecknadel bis zur Schrankwand“, sagt Axel Drieschner, rund 170 000 Objekte insgesamt.
Die ausgestellten Objekte tragen Spuren ihrer ehemaligen Besitzer*innen. Das ist wichtig „und unterscheidet uns von einem Design-Museum“, sagt der Kurator. Sendereinstellungen und Aufkleber auf alten Stern-Radios geben zum Beispiel Aufschluss über die politische Einstellung der Haushalte, in denen sie einst standen. So werden die Exponate auch in einen politischen Kontext gesetzt.
In einem Raum verweisen selbstgeschneiderte Kleider auf westliche Mode-Ideale, Kreativität und die Mangelwirtschaft, in der solche Stücke nicht erhältlich waren. Was es nicht zu kaufen gab, wurde eben selbst produziert.
Wie die besagte Lederhose, die Axel Drieschner vorsichtig aus der Vitrine holt und präsentiert. Ein junger Rockfan namens Thomas hat sie sich schneidern lassen. In dem Audioguide des Museums erzählt er ihre Geschichte: Lederhosen wie diese konnte man in der DDR nicht kaufen. 300 Ostmark bezahlte er für das Leder, 300 Ostmark fürs Nähen. Das waren zwei Monatsgehälter, aber sie waren es ihm wert. „Das Stück hat mich ständig begleitet“, erzählt Thomas. Er trug sie stolz und häufig auf den vielen Rockkonzerten, die er besuchte. Für ihn war das ungewöhnliche Kleidungsstück Ausdruck seines Lebensgefühls und zugleich ein Statussymbol, mit dem er auf Konzerten Aufsehen erregen konnte. Nun liegt sie im Museum - als Beweis, dass Menschen in der DDR sich ihre ganz eigenen Freiräume schufen.
Sabrina KotzianEin Vorbild für die Arbeiterklasse
Sabrina Kotzians Interesse gilt insbesondere der DDR-Kunst und deren Rolle in der sozialistischen Ideologie. Sie hat dieses Gemälde von Walter Womacka ausgewählt, um zu zeigen, wie die offizielle Kunst in die private und persönliche Sphäre hineinreichte. Von dem in der DDR hoch angesehenen Maler stammen auch das Fries am Haus des Lehrers am Alexanderplatz in Berlin sowie Wandgemälde im Staatsratsgebäude der DDR.
1980/81 malte Womacka die Arbeiterikone Erika Steinführer, die in einem Betrieb Glühbirnen produzierte. Stolz und ernst sitzt sie da, mit riesigen Händen. Jeder kannte diese Frau – und jeder kannte den Maler in der DDR: „Sein Bild ´Das junge Paar´ gab es als Reproduktion gratis beim Kauf der Schrankwand dazu“, erzählt Sabrina Kotzian. Überhaupt hätten Kunstdrucke in der DDR eine große Rolle gespielt: "Kunst war leicht zugänglich und wurde zugleich politisch instrumentalisiert."
Auf Friesen, Gemälden und mit Statuen wurde die Arbeiterklasse gefeiert. Das ehrte die Werktätigen und schränkte den künstlerischen Freiraum der Kreativen zugleich immens ein. Staatskunst sollte verständlich und mit einer klaren Botschaft ausgestattet sein. Und sie wurde mit Nachdruck zu den Bürger*innen gebracht, wie Kotzian erzählt. Der sozialistische Kunstkanon reichte in die Arbeitswelt und das Privatleben. Der volkseigene Betrieb, in dem die Menschen ihren Arbeitstag verbrachten, organisierte am Feierabend Kulturveranstaltungen, man besuchte mit Arbeitskolleg*innen Theater und Museen. Kultur war kein Privatvergnügen, sondern diente der Vermittlung sozialistischer Ideale.
Das sind die Assoziationsräume, die Womackas Bild in Eisenhüttenstadt öffnet. Sie unterscheiden sich wegen der jeweils spezifischen Sozialisation erheblich bei west- und ostdeutschen Betrachtenden. Viele Besucher*innen aus dem Osten bleiben vor dem Bild stehen, weil sie es kennen, beobachtet Kotzian.
Die DDR-Staatskunst fand mit dem Mauerfall ein jähes Ende und wurde pauschal als ideologisch motiviert abgewertet. „Damit fällt die Repräsentation des stolzen Arbeitermilieus seit 1990 weg“, erklärt die Kunsthistorikerin. Immerhin sei der Blick wieder differenzierter geworden. Die Bewertung der DDR-Kunst steht nicht still, sondern wird sich weiterhin verändern, ist Sabrina Kotzian überzeugt.
Antje RamothBruderländer und Klassenfeinde
In dem Buch ist eine seither untergegangene Weltordnung eingefroren. Die BRD und die DDR sind dort wie zwei Länder abgebildet, die Nachbarn und nicht etwa ein geteiltes Land sind. Die Mauer ist dort einfach ein unspektakulärer Grenzstrich. „Das sind zwei völlig getrennte Staaten. So haben wir es gelernt“, sagt Antje. Auf der einen Seite die sozialistischen Bruderländer, im Westen der kapitalistische Klassenfeind.
Der alte Schulatlas repräsentiert für Antje nicht nur die Weltordnung ihrer Kindheit und Jugend, sondern auch ihres frühen Interesses an der weiten Welt. Sie hatte zu DDR-Zeiten Brieffreunde in Amerika, Japan und der Sowjetunion, der Ukraine und Algerien. Doch zornig darüber, dass sie viele Länder der Erde als DDR-Bürgerin nicht besuchen durfte, war sie damals nicht. “Ich habe gedacht, es wäre schön zu reisen. Aber ich habe auch hingenommen, dass es eben nicht ging. So wie andere es hinnehmen, dass sie sich nie ihr Traumauto leisten werden können.“
Das DDR-Schulsystem und die Jugendorganisationen wie die Thälmann-Pioniere bereiteten die Jugend auf das Leben im und die Verteidigung des Sozialismus vor. Im Wehrunterricht übten die Schüler*innen Weitwurf mit Handgranaten-Attrappen. „Für uns war das normal,“ sagt Antje Ramoth Sie denkt gerne an die Sommer im Ferienlager der Pioniere zurück. Einige Erinnerungen an damals bewahrt sie in einer Box: Das Halstuch der Thälmann-Pioniere mit den Unterschriften von Freunden, mit denen sie gemeinsam den Sommer im Jugendlager verbrachte. Das Liederbuch der Pioniere.
Mitten in ihrer Pubertät fiel die Mauer. Ein neuer Schulalltag mit neuen Strukturen begann, mit Wahlfächern statt eines vorgegebenen Stundenplans, neuem Lernmaterial, unbekannten Lehrern und einer Zensurenskala, die statt von 1 bis 5 plötzlich von 1 bis 6 reichte.
Das Ende der DDR kam für Antje früh genug, um die neuen Freiheiten zu nutzen. „Ich hatte Sehnsucht, etwas Neues zu entdecken.“ 1991/1992 verbrachte sie ein Jahr in den USA bei Mormonen in Utah. „Ausgerechnet ich, als Atheistin“, sagt sie lachend. Der erste Flug ihres Lebens ging nach Atlanta. Als sie Jahre später auf einem Einreiseformular in die USA nach früheren Staatsbürgerschaften gefragt wurde, musste sie stutzen: „Muss ich jetzt da DDR eintragen?“ Aber das Land stand gar nicht auf der Liste der Optionen. Ihr Heimatland existiert nicht mehr, ihre frühere Staatsbürgerschaft damit ebenso wenig.
„Ich war jung genug, um mich ohne Groll an die DDR zu erinnern“, sagt sie. Jung genug, um mit den neuen Bedingungen zurecht zu kommen. Für ihre älteren Geschwister, die bereits in Ausbildungen und Studium steckten, sei es schwieriger gewesen. Antje Ramoth studierte zunächst nach der Schule Soziologie in Potsdam und zog dann nach Baden-Württemberg. Dort ist sie mit einen Schwaben verheiratet und hat viele Freunde aus Ostdeutschland. „Die Ossis rotten sich im Westen zusammen“, sagt sie lachend. Ein wenig so wie ausgewanderte Deutsche es im Ausland auch tun. Auch, weil in so einer Runde vieles einfach keiner Erklärung bedarf. Eine Jugend bei den Thälmann-Pionieren ist dann keine Exotik, sondern einfach Teil einer ganz normalen Kindheit in der DDR.
Cornelia JurrmannMit den Abrafaxen nach Ägypten
Eines ihrer liebsten Fotos aus ihrer Kindheit zeigt sie in der Badewanne mit einem Mosaik-Comic in der Hand. Es ist Heft 6 aus dem Jahr 1983. In ihm reisen die Abrafaxe nach Ägypten. „Ich bin mit den Abrafaxen aufgewachsen“, sagt die 1977 in Altdöbern geborene und in Vetschau im Spreewald aufgewachsene Geisteswissenschaftlerin. „Abrax, Brabax und Califax- Jeden Monat gab es ein neues Heft, der Vater kaufte es am Kiosk und brachte es den drei Kindern mit nach Hause. „Und dann haben wir uns fast darum gestritten, wer es als erstes lesen durfte.“ Keine Frage also: Sie wollte die Sammlung unbedingt haben, als ihre Eltern vor einigen Jahren ihre Kindheitserinnerungen aus ihrem Keller holten und verteilten.
Die Mosaik-Hefte waren die sozialistische Antwort auf US-Comics wie Mickey Maus, die in der DDR Bildergeschichten hießen. Erst waren es die knollennasigen Digedags, die in den Geschichten die Welt erkundeten und ihren meist jungen Leserinnen und Lesern auch immer dabei historischen Fakten vermittelten. 1976 wurden sie nach einem Streit mit dessen Urheber, dem Zeichner Hannes Hegen, durch die drei sehr ähnlichen Figuren - die Abrafaxe - abgelöst. Dem Erfolg schadete dieser Bruch nicht. Die Kinder in der DDR freuten sich auf deren Abenteuer wie ihre Altersgenossen im Westen auf Donald Duck, Goofy und Micky Maus oder auch Asterix und Obelix.
Die Abafraxe reisten um die Welt und die jungen Leserinnen und Leser mit ihnen. Wie passt das zu einem Land, das seine Bewohner nicht in die Ferne ziehen ließ? „Sie reisten ja durch Raum und Zeit und immer in die Vergangenheit und nicht das Ausland der Gegenwart“, sagt Cornelia Jurrmann. Abrax, Brabax und Clarifax beamten sich zum Beispiel ins alte Rom, nach Ägypten, ins kaiserliche Wien und nach Indien. Dort erlebten sie Abenteuer an der Seite der mächtigen Sultane und Herrscher, aber auch der Schwachen und Unterdrückten. Einen erhobenen Zeigefinger oder moralische Belehrungen verkniffen sich die Macher. Dafür gab es durchaus ironische Anspielungen auf das Leben in der DDR. In der ersten Ausgabe des Jahres 1988 bricht im Königreich Orissa ein selbstgebautes Gefährt namens Traffi bei der Überwindung eines Hindernisses auseinander. Immer diese Materialfehler, flucht der Fahrer. Und als hätten die Macher den Zusammenbruch der DDR geahnt, trägt das erste Heft des Jahres 1989 den Titel „Die Fahrt ins Ungewisse“, gefolgt von „Unfreundlicher Empfang“.
Die Digedags und später die Abrafaxe, das war auch immer eine Portion Geschichtsunterricht. Die Fakten stimmten: Darauf wurde penibel geachtet. Auf wessen Geheiß, steht auf der letzten Seite: Herausgeber: Zentralrat der FDJ, veröffentlicht unter der Lizenz Nr. 1233 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR.
Die Mosaik-Hefte erscheinen noch immer, seit vielen Jahren in einem anderen Verlag. Die alten Ausgaben genießen heute Sammlerstatus, für einzelne Ausgaben werden im Internet bis zu 60 Euro geboten. Cornelia Jurrmann hat nur jene aus den DDR-Jahren, aus ihrer Kindheit aufbewahrt. Mit der Wende wurde die Welt größer, andere Dinge interessanter als die Abrafaxe. „Vom Begrüßungsgeld habe ich mir ein Skateboard gekauft“, erinnert sie sich. Sie war damals 12 Jahre alt. Später studierte sie Geschichte, Politik und Soziologie, zunächst in Potsdam, dann in Berlin, wo sie heute noch wohnt, und zwar in Pankow, dort, wo ihre Mutter aufgewachsen ist. Ihre Comic Sammlung ist nun der Schlüssel für ihre ganz persönliche Zeitreise zurück in ihre Kindheit - gemeinsam mit den Abrafaxen.
Günter L."Das Wertvollste, was ich hatte"
Also trug er nur seinen besten Anzug, als er am frühen Abend wie verabredet an der Raststätte Michendorf von einem Verbindungsmann leise angesprochen wurde. Der brachte ihn und die beiden Frauen in seinem Auto zu einem anderen Rastplatz, wo das eigentliche Fluchtauto auf sie wartete: Es war eine große Limousine, wohl zugelassen auf die alliierten Streitkräfte oder Diplomaten, denn beide Gruppen wurden an der Grenze nicht kontrolliert. Genaueres weiß Günter L. nicht, er sollte es nicht wissen. Für den Fall, dass sie erwischt wurden, konnte er so nichts preisgeben. Es hätte alle Beteiligten in der DDR in große Schwierigkeiten gebracht und künftigen Flüchtlingen Wege verbaut.
Was er von jenem Tag erzählt, klingt wie ein Agentenkrimi. Es war stockdunkel als die Drei in den Kofferraum kletterten. Die Frauen waren nervös, L. befürchtete, sie könnten sich in Panik bemerkbar machen. Doch an der Kontrollstelle Drewitz passierten sie unbemerkt die Grenze. Im westdeutschen Helmstedt öffnete sich schließlich der Kofferraum. Sie hatten es geschafft, ein weitereres Fahrzeug brachte sie noch in der Nacht nach Hannover. In Berlin warteten seine Mutter und ihre Schwester auf den erlösenden Anruf. Die beiden waren bereits ein Jahr zuvor nach West-Berlin übergesiedelt. Auch seine damalige Freundin, die vom Westen aus Geld für die Fluchthelfer aufgetrieben hatte, war aus ihrer süddeutschen Heimat gekommen.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch seine goldene Taschenuhr, eine Schweizer Longines aus der Vorkriegszeit, bereits in West-Berlin. Günter L. hatte sie seiner Mutter in weiser Voraussicht ein Jahr vor seiner Flucht bei ihrer Übersiedlung mitgegeben. „Sie war das Wertvollste, das ich damals besessen habe“, sagt er. Er hatte die Uhr 1966 einer Bekannten abgekauft. Für 600 DDR Mark, seinen ersten Monatslohn als Assistent in der mathematischen Fakultät der Humboldt-Universität, erinnert er sich. Er, der 1945 als Zweijähriger mit seinen Eltern aus Schlesien als Vertriebener nach Potsdam gekommen war, wollte etwas besitzen, das er einmal seinen Kindern vermachen konnte. Denn auf der Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg hatten seine Eltern alles zurück lassen müssen. So wie er 25 Jahre später. Die Uhr war als Erbstück gedacht. Sie ist eines der ganz wenigen Dinge, die er aus seiner DDR-Zeit noch besitzt. Er hält sie in Ehren und trägt sie zu besonderen Anlässen, stilvoll mit Weste.
Auch wenn Günter L. so packend erzählt, als wäre es gestern gewesen: Seine aufregende Flucht ist lange her. Seit mehr als 50 Jahren ist West-Berlin seine Heimat. Hier bauten sich seine Frau und er ein gemeinsames Leben auf, das so in der DDR nicht möglich gewesen wäre. Die beiden hatten sich bereits kurz vor dem Mauerbau, im Sommer 1961 in West-Berlin auf einem Treffen west- und ostdeutscher evangelischer Christen kennen gelernt. Da war die junge Frau 16, er 18 Jahre alt. Dann überschlugen sich die Ereignisse, die Grenze wurde geschlossen. L.`s einziger Lichtblick war ein Mathematik-Studienplatz an der Humboldt-Uni in Ost-Berlin, Den hatte er bekommen, weil sein Schuldirektor sich für ihn eingesetzt hatte. Als bekennender Christ konnte er in der DDR eigentlich keine Karriere erwarten. Sein Glück war, dass Walter Ulbricht die Mathematik als Wissenschaft der Zukunft deklariert hatte. Die DDR brauchte junge Talente wie den jungen Potsdamer, auch wenn sie kein Parteibuch hatten. Er blieb und studierte. „Ich habe neben der Gesellschaft gelebt“, sagt er heute über diese Jahre.
Derweil hielten seine Freundin und er Kontakt, trafen sich in Ungarn und Prag, schrieben Briefe. Doch spätestens als 1968 sowjetische Panzer in Prag brutal alle Hoffnungen auf Reformen niederwalzten, war den beiden klar, dass eine Entscheidung not tat. An seiner Universität sollte der Mathematiker – mittlerweile Assistent - unterschreiben, dass der russische Einmarsch eine „friedenserhaltende Maßnahme“ gewesen sei. Ihm war klar, dass er nicht bleiben konnte. “Da haben wir beschlossen, eine Lösung zu finden.”
Wie viele Systemkritiker war L. in der Kirche verwurzelt. Dort waren und sind immer noch seine Gleichgesinnten. Und so war es auch der kleine Kirchen-Anstecker am Revers, der ihn an der Ost-Berliner Uni die Flucht eröffnete. Er wurde angesprochen, organisierte mithilfe seiner Freundin im Westen das Geld für die Fluchthelfer und bereitete sich vor.
Wenige Monate später begann er in West-Berlin ein neues Leben, nur wenige Kilometer von seinem alten entfernt und doch in einer anderen Welt. Die Freundin zog 1970 nach Berlin, ein Jahr später heirateten die beiden, bekamen zwei Kinder. Der Mathematiker nahm eine Stelle in der Computerabteilung eines großen Elektrokonzerns an und arbeitete unter anderem an der Entwicklung der ersten rechnergesteuerten Koffertransportanlagen auf Flughäfen mit, ohne die der Flugbetrieb heute gar nicht denkbar wäre. Er kam in der Welt herum, die Familie lebte auch für einige Monate in den USA. 2006 ging er in den Ruhestand. Bis zum Mauerfall hatten sie ein offenes Haus für jene, die aus der DDR freigekauft oder geflohen waren, beherbergten viele vorübergehend auf dem Weg in ein neues Leben.
Den Mauerfall im Herbst 1989 haben seine Frau und er verschlafen. Sie war keine Zäsur in ihrem Leben, die beiden waren auch vor der Öffnung mit der Dahlemer Kirchengemeinde häufig in der DDR unterwegs. L. weint deren Untergang keine Träne nach. „Ich war diesem Land gegenüber immer sehr distanziert.“
Edith und Manfred Sohn"Ich konnte immer aufrecht gehen"
Auch diese Weite und die U-Bahn vor der Tür waren es, die Edith und Manfred Sohn vor nunmehr 45 Jahren für diese Wohnung begeisterten. Zuvor lebten sie in Berlin-Mitte, direkt gegenüber vom heutigen Auswärtigen Amt. Heute ist Mitte das häufig überlaufene touristische Herz Berlins, damals war es dort an den Wochenenden relativ ruhig. Mit zwei kleinen Töchtern zog es die Familie in eine größere Wohnung und eher ins Grüne.
In „die Stadt“ fahren sie auch heute noch gerne, gehen shoppen, ins Theater, Museum, oder Kino. Oder schauen einfach, was es Neues gibt. Doch wenn sie an Stelle des einst im Sonnenlicht orange strahlenden Palastes der Republik nun eine Schloss-Replik alter preußischer Glorie sehen, so schmerzt sie das schon, sagt Edith Sohn.
Ihre fast 80 Jahre sieht man ihr nicht an, wenn sie lachend und voller Energie aus ihrem Leben erzählt. Ihr drei Jahre älterer Mann und sie waren Flüchtlingskinder. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend im Erzgebirge und in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Nach Abschluss der 10. Klasse lernte sie den Beruf Stenotypistin. 1966 zog es sie nach Berlin. Da war die Stadt bereits geteilt. In den sechziger Jahren arbeitete sie dort als Sekretärin unter anderem im "Zentralrat der Freien Deutschen Jugend" in der Prachtstraße Unter den Linden. Heute ist in dem Gebäude das Hauptstadtbüro des ZDF untergebracht.
Manfred Sohn wuchs in einem Dorf in Sachsen-Anhalt mit fünf Geschwistern auf und studierte nach dem Abitur an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt Maschinenbau und Schweißtechnik. An dieser Hochschule lernten sich beide auf einer Faschingsveranstaltung 1966 kennen. Edith hat immer gerne getanzt, noch heute trifft sie sich jede Woche zum Reigen-und-Swing-Tanzen.
Im Mai 1969 heirateten sie. Manfred Sohn promovierte in Karl-Marx-Stadt und bekam in Berlin einen Job in der Bauakademie der DDR, der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung für Architektur und Bauwesen. Später wurde er zum Professor berufen und leitete 16 Jahre lang dort den Bereich Wissenschaft und Technik. Manfred Sohn war dort auch an der Entwicklung des modernen Plattenbautyps Wohnungsbauserie 70, kurz „WBS 70“, beteiligt dessen erstes Gebäude 1973 errichtet wurde. Mit dieser besonders günstigen sogenannten Einheitsplatte ließen sich in Windeseile dringend benötigte Wohngebäude errichten. Ein interessantes Detail: Die Ostberliner Platte orientierte sich an der Gesamtberliner Traufhöhe, an dem Maßstab, der auch im Westen der Stadt historisch für Wohngebäude galt. „Dahinter stand der Gedanke, dass wir irgendwann wieder eine Stadt werden“, erzählt Manfred Sohn. Und so kam es dann ja auch.1989 fiel die Mauer.
Doch bei der Erinnerung an den ersten Besuch im Westen der Stadt überwiegt bei Edith nicht die Freude über die sich öffnende Grenze, sondern die Scham über die eigenen Landsleute. „Die führten sich dort auf, als hätten sie Jahrzehnte lang in der DDR hungern müssen.“ Würdelos sei es gewesen, so empfand sie es. „Natürlich haben auch wir uns über vieles geärgert, aber mit etwas Kreativität und „Vitamin B“ konnte man alles haben, was man brauchte. Wir hatten eine schöne und günstige Wohnung, Gesundheitsversorgung, Schule und Kita für unsere Töchter gleich vor der Tür, eine Datsche im Umland. Und niemand musste um seinen Arbeitsplatz fürchten.“ Ansonsten machte man sich wenig Gedanken um seine Zukunft. „Ja klar, wir durften nicht überall hin reisen, aber als Jugendliche war ich mit Jugendtourist zum Beispiel in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Sowjetunion, Polen und der Tschechoslowakei. Da war es auch schön.“
In ihrem Haushalt gibt noch einige gut funktionierende Dinge aus DDR-Zeiten, darunter die nunmehr 40 Jahre alte Haushaltsnähmaschine VERITAS, hergestellt im Nähmaschinenwerk Wittenberge. Das Nähen hat Edith von ihrer Mutter gelernt. Als junges Mädchen schneiderte sie sich weite bunte Röcke und Petticoats, als Mutter ihren Kindern dann Kleider und kürzte Hosen. Die VERITAS steht in einem kleinen Zimmer der Wohnung und lässt sich bei Bedarf im Handumdrehen aus der Versenkung erheben. Sie war nie defekt, in all den Jahren nicht, verrichtet immer noch zuverlässig ihren Dienst. Ebenso das Mascott-6030-Radio ihres Mannes. Manfred Sohn erwarb es bereits während seines Studiums in den sechziger Jahren in Karl-Marx-Stadt. Es sollte damals helfen, die störend lauten Geräusche der Straßenbahn vor seinem Fenster zu übertönen. 190 Mark hoch war sein Stipendium. Das Radio kostete 140 Mark und war eine echte Investition. Seit Jahrzehnten steht es nun im Regal der kleinen Küche und läuft täglich. „Die Geräte halten, weil sie auf eine lange Lebensdauer und nicht als Wegwerfartikel ausgelegt waren“, sagt Edith Sohn.
„Wir sind DDR-Menschen“, sagt Edith Sohn. Sie war in ihren Augen das bessere deutsche System. Der Hochmut der Westdeutschen, die ihnen kurz nach dem Mauerfall in Berlin erklärten, nun könnten sie endlich aufrecht durchs Leben gehen, hat sie erzürnt. „Ich konnte immer aufrecht gehen“ entgegnete sie damals jenem Fremden, der sie auf dem Gendarmenmarkt ansprach. Sie konnte vielmehr nach der Wiedervereinigung nicht fassen, in welch traditionelles Rollenbild sich Frauen in der BRD nach dem Krieg hatten pressen lassen. „Mir war immer klar, dass ich mein eigenes Geld verdienen und niemals abhängig von einem Mann sein wollte.“ Und das hat sie ihr Leben lang getan, nur unterbrochen von einigen Monaten nach der Geburt ihrer Kinder. Mit der Wiedervereinigung lösten sich für viele DDR-Bürgerinnen und Bürger die gewohnten Strukturen und Sicherheiten in Luft auf. Auch die Sohns mussten sich neu orientieren. Es war keine leichte Zeit, aber sie fanden ihren Weg. Edith Sohn fand rasch wieder Arbeit, ihr Mann machte sich selbständig im Bereich der energetischen Gebäudesanierung und arbeitete als Energieberater und Dozent an verschiedenen Hochschulen und Weiterbildungsinstituten. Ihre beiden Töchter waren noch Teenager. Sie kamen recht gut mit den Veränderungen zurecht, studierten und haben heute recht gute Arbeitsbedingungen, sagen die Eltern.
Neugierig waren und sind die Sohns noch immer. Nach der Maueröffnung machten sie eine Deutschlandrundfahrt mit ihrem neuen Auto. Dann schauten sie sich jene die Teile der Welt an, die ihnen zuvor verschlossen geblieben waren, reisten unter anderem nach Griechenland, Spanien, England, Schweden und in die USA. Es ist ein kurzweiliger Besuch. Zum Schluss erzählt Edith Sohn noch lachend eine Anekdote: Harry Belafonte, der große von ihr verehrte Sänger und Bürgerrechtler war zu Gast im Ost-Berliner Kino International. Zum Schluss signiert er für die Schlange stehenden Menschen seine Bücher,eines nach dem anderen, ohne dabei groß aufzuschauen. Doch sie wollte unbedingt einen kurzen Blick von ihm, eine kurzen Kontakt. Aber wie? „Als ich dran war habe ich einfach leise zu ihn gesamt: Harry, I love you. Da hat er hoch geblickt und mich angelächelt.“

































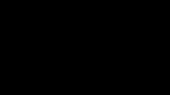
 Aus einem anderen Land
Aus einem anderen Land
 "Dr. Oetker kommt uns nicht ins Haus"
"Dr. Oetker kommt uns nicht ins Haus"
 Der Glücksfall von der Leipziger Messe
Der Glücksfall von der Leipziger Messe

 Widerstand in Lederhosen
Widerstand in Lederhosen
 Lederhose
Lederhose
 Ein Vorbild für die Arbeiterklasse
Ein Vorbild für die Arbeiterklasse
 Bruderländer und Klassenfeinde
Bruderländer und Klassenfeinde
 Mit den Abrafaxen nach Ägypten
Mit den Abrafaxen nach Ägypten
 "Das Wertvollste, was ich hatte"
"Das Wertvollste, was ich hatte"


 "Ich konnte immer aufrecht gehen"
"Ich konnte immer aufrecht gehen"